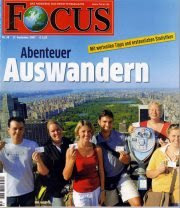Donnerstag, 24. Juli 2008 23:39 - Von Lars Haider
Nun reist er nach Frankreich - nachdem er Berlin erobert hat: 215.000 Menschen kamen zur Siegessäule, um die Rede von US-Präsidentschaftsbewerber Barack Obama zu hören, fünf Millionen Menschen sahen am Fernseher zu - und Barack Obama sah aus wie der kommende US-Präsident. Wie der US-Politiker das geschafft hat, konnte Morgenpost Online aus der Nähe beobachten.
Foto: AP
Mehr als 200.000 Berliner waren am Donnerstag zur Siegessäule gekommen, um Barack Obamas Rede zu hören. Offenbar hat er sie wie die meisten Deutschen überzeugt.
Foto: REUTERS
Am Freitagmittag nahm er Abschied: Barack Obamas letzter Blick auf Berlin. Die nächsten Stationen auf seiner Reise waren Paris und London.
Foto: DPA
Nachdem Obama seinen Berlin-Aufenthalt am Freitag um ein paar Stunden verlängert hatte, verließ der Präsidentschaftskandidat gegen 13.20 Uhr das Hotel Adlon über den Hinterausgang.
Foto: DPA
Hunderte von Berlinern warteten dort und in der Nähe des Hotels, um noch einen Blick auf Obama zu erhaschen.
Foto: AP
Einmal noch aus dem Fenster winken - Obama dürfte seine Reise nach Berlin als Erfolg betrachten.
Foto: AP
Auf dem militärischen Teil des Flughafens Tegel bedankte sich der Kandidat noch einmal artig bei der Polizei.
Foto: REUTERS
Er schritt die Reihe ab wie bei einem offiziellen Staatsbesuch.
Foto: AP
Zum Schluss noch ein Gruppenfoto mit Flugzeug und Polizisten.
Foto: AP
Schließlich stieg Obama in seine "Obama One".
Foto: AFP
Ob er künftig in der "Airforce One" reisen wird, zeigen die kommenden Monate.
Foto: REUTERS
Der Berlin-Besuch könnte dazu beigetragen haben. Denn diese Bilder gehen um die Welt: Der neue amerikanische Hoffnungsträger in Berlin vor einer beeindruckenden Kulisse.
Foto: DPA
Nach seiner Rede nahm Obama ein Bad in der Menge.
Foto: DDP
Und wurde begeistert aufgenommen.
Foto: REUTERS
Das war für die Männer von der Sicherheit Schwerstarbeit.
Foto: AP
Sie sorgten dafür, dass Obamas Botschaft in die Welt transportiert wurde: die zahlreichen Journalisten.
Foto: Michael Brunner
Und nach der Rede ging's zum Schnitzel-Spezialisten: Barack Obama speiste im Restaurant "Borchardt".
Foto: AP
Sein republikanischer Kontrahent John McCain und Senator Lindsey Graham hatten die Worte Obamas in "Schmidt's Fudge Haus" in Columbus (Ohio) verfolgt.
Foto: DDP
Der US-Senator rief den Besuchern zu: "Völker der Welt, schaut auf Berlin."
Foto: REUTERS
Der Auftritt wurde auf Leinwänden übertragen.
Foto: REUTERS
19.20 Uhr betrat Barack Obama die Bühne an der Siegessäule.
Foto: DDP
Er winkte den Menschen zu und wurde mit viel Beifall begrüßt.
Foto: DPA
Rund 215.000 Menschen hatten ihn erwartet.
Foto: REUTERS
An der Bühne drängten sich die Menschen.
Foto: DDP
Jeder zeigt seine Sympathie für den US-Präsidentschaftskandidaten anders. So ...
Foto: DDP
... oder mit einem mitgebrachten Foto.
Foto: DPA
Die Vorfreude auf die Rede Barack Obamas war groß.
Foto: DPA
Dieser Mann möchte, dass Obama in Deutschland kandidiert.
Foto: AFP
Und so hatte der erste Tag seines Berlin-Besuchs begonnen: Kurz vor seinem Abflug nach Berlin stellt sich Barack Obama in seiner Maschine noch der israelischen Presse in Tel Aviv.
Foto: AP
Ankunft in Berlin: Kurz vor 10 Uhr landet die Obama One auf dem militärischen Teil des Flughafen Tegel.
Foto: REUTERS
Obamas Maschine hält neben dem Flugzeug des irakischen Premierministers Nuri al-Maliki, der ebenfalls auf Berlin-Besuch ist
Foto: DPA
Eisbären-Protest: Aktivisten der Umweltschutzorganistaion WWF nutzen den Besuch, um Obama zum Kampf gegen den Klimawandel aufrufen.
Foto: DPA
Andere betätigen sich vor dem Brandenburger Tor als Touristenattraktion und heißen als solche Obama willkommen.
Foto: AP
Die Begeisterung über den Besuch in Berlin dürfte überwiegen.
Foto: REUTERS
Hier ein besonders begeisterter Obama-Fan.
Foto: AP
Kurz vor 11 Uhr trifft Obama am Kanzleramt ein. Dort warten Kanzlerin Angela Merkel und Dutzende Berliner Fans, die ihn sehen wollen.
Foto: DDP
Obama und Merkel auf dem Balkon des Kanzleramtes dürften von dem einsamen Demonstranten nicht gestört worden sein.
Foto: AP
Um 11 Uhr empfing Angela Merkel Obama im Kanzleramt. Sie winkten freundlich vom Balkon.
Foto: AP
Vor dem Kanzleramt, wo es sonst menschenleer ist, drängen sich heute die Berliner.
Foto: REUTERS
Merkel zeigte Obama das Kanzleramt.
Foto: AP
Obama lässt sich von Merkel führen: Rund eine Stunde war er Gast im Kanzleramt.
Foto: REUTERS
Bei den Gesprächen sollte es um den Klimaschutz, Welthandel und die Beziehungen zwischen Europa und den USA gehen.
Foto: REUTERS
Reichstagskulisse: Und Obama war beim Treffen mit Merkel zum ersten Mal am Tag vor einem Berliner Wahrzeichen zu sehen.
Foto: DDP
Wenn Obama nicht Präsident wird, düfte dies sein letztes Bild vor dieser Kulisse und in dieser Begleitung sein.
Foto: REUTERS
Die Kanzerlin und Obama scheinen sich angeregt zu unterhalten.
Foto: REUTERS
Angela Merkel wird laut, Obama lächelt.
Foto: DPA
Dem Anwärter auf das Weiße Haus scheint die moderne Architektur des Kanzleramts zu gefallen.
Foto: DPA
Ein freundlicher Gruß an die Fotografen ...
Foto: DDP
Vorm Brandenburger Tor wollte Obama eigentlich seine Rede halten. Doch die Kanzlerin befand den Ort für ungeeignet.
Foto: DPA
Gegen Mittag füllt sich der Platz vor dem Brandenburger Tor.
Foto: DPA
Einmal den möglicherweise künftigen US-Präsidenten sehen: Dutzende Schaulustige warteten hinter der Absperrungen auf Obamas Ankunft im Adlon.
Foto: DPA
Die Medien rüsten sich schon für den Auftritt Obamas an der Siegessäule, vor der Obama um 19 Uhr reden wird.
Foto: DPA
Obama in einem weißen Van auf dem Weg zum Adlon, wo er während seines Berlin-Aufenthalts wohnen wird.
Foto: DPA
Nun übernachtet Obama wenigstens in unmittelbarer Nähe zum Brandenburger Tor, vor dem er eigentlich reden wollte.
Foto: DPA
Die Polizei hatte alle Mühe, den Adlon-Eingang freizuhalten.
Foto: REUTERS
Obama betritt den Fahrstuhl des Adlon. In dem Berliner Traditionshotel gilt die höchste Sicherheitsstufe.
Foto: DPA
Dieser Mann will Obama etwas größer sehen
Foto: DDP
Doch es gibt nicht nur Fans...
Foto: REUTERS
... sondern auch bekennende McCain-Fans
Foto: DPA
Underdessen trifft die Fahrzeugkolonne am Auswärtigen Amt ein, wo Obama bereits erwartet wird
Foto: DPA
Obama verlässt seinen weißen Van und trifft...
Foto: AP
... den deutschen Außenminister Frank Walter Steinmeier. Er ist der zweite Politiker nach der Kanzerlin, den Obama in Berlin trifft
Foto: REUTERS
Die Fotografen bitten Obama, noch ein wenig zu posieren...
Foto: DPA
...was Obama gern tut
Foto: REUTERS
Dann beginnt der offizielle Teil des Besuchs. Die beiden Politiker ziehen sich zum Gespräch zurück
Foto: AP
Auch hier versammeln sich Freunde des Politikers. Obama wird gern mit Kennedy verglichen
Foto: AP
Weiträumige Absperrungen vor dem Brandenburger Tor
Foto: DPA
Wer sich vordrängelt, wird von der Polizei ermahnt, wie dieser verirrte Drehorgelspieler
Foto: DPA
Am Nachmittag traf Barack Obama Berlins regierenden Bürgermeister. Der hatte eine Bären-Firgur mitgebracht ...
Foto: DDP
... und außerdem hatte Klaus Wowereit das Gästebuch der Stadt mit. Das ist für Gäste - ins "Goldene Buch" dürfen sich nur Staatsmänner eintragen.
Foto: AP
Barach Obama trug sich ein.
Foto: DDP
Obama schrieb: "Berlin ist ein Symbol für den Sieg der Hoffnung über die Angst und dafür, dass es unmöglich ist, Menschen in ihrem Streben nach Freiheit zu trennen. "
Foto: REUTERS
Mit Obamas Besuch lässt sich auch ein Geschäft machen: Dieser Straßenverkäufer bietet ....
Foto: DPA
.. diese Buttons mit einem eingedeutschten Obama an.
Foto: DPA
Und auch solche Abzeichen werden werden auf der Straße verkauft.
Foto: DPA
Obama traniert: Am Nachmittag machte der US-Präsidentschaftskandidat eine Pause und besuchte das Fitness-Studio im Ritz Carlton
Foto: Sergej Glanze
So sieht es im Wellness-Bereich des Ritz-Carlton aus. Hier traniert Barack Obama.
Foto: Sergej Glanze
Und wenn er möchte, dann kann der US-Präsidentschaftskandidat auch im Wasser entspannen.
Barack Obama mag Orte wie diesen. Er ist langsam nach vorn gegangen, an das Rednerpult im Schatten der Siegessäule. Die lange Flucht bis zum Brandenburger Tor dürfte ihn an Washington erinnern, an die imposante Achse zwischen Capitol und Lincoln Memorial. Dort joggt er abends gern, meist nur bis zum Washington Monument, das auf halber Strecke liegt, manchmal aber auch bis zum Ende, die berühmten Treppen hinauf. „Ich stelle mir die Menschenmenge vor, die Martin Luther King 1963 mit der mächtigen Schlusskadenz der berühmten Rede besänftigte, die er beim Marsch auf Washington vor dem Lincoln Memorial sah. Und an diesem Ort denke ich an Amerika und die Menschen, die es geschaffen haben. Ich denke an die Gründer dieser Nation, denen es irgendwie gelang, kleinlichen Ehrgeiz und engstirniges Kalkül zu überwinden und sich eine Nation vorzustellen, die sich auf einem ganzen Kontinent entfaltet.“
Nun ist er dran. Nicht in Washington zwar, aber immerhin in Berlin. Zu seinem einzigen öffentlichen Auftritt in Europa sind 215.000 Menschen gekommen. Sie schauen zu ihm hoch, sie jubeln – ohne, dass er ein Wort gesagt hat. Es wird 19.22 Uhr, bevor Barack Obama die Rede beginnt, die allein schon deshalb historisch ist, weil er noch nie vor einer größeren Menge gesprochen hat. „Ich danke den Bürgern Berlins. Ich danke dem deutschen Volk“, sagt er. Dann, etwas später: „Völker der Welt, schaut auf Berlin. Menschen Berlins – Menschen der Welt – dies ist unser Augenblick. Dies ist unsere Zeit.“
Mit diesen Sätzen hat auch für Candy Crowley und Dan Balz der wichtigste Teil des Tages angefangen. Die Korrespondentin von CNN und der „senior political writer“ der renommierten „Washington Post“ sind am Morgen mit Barack Obama in seiner gecharterten Boeing 757 von Israel nach Berlin geflogen. Sie gehören zu der „the bubble“ genannten Gruppe von rund 40 Journalisten, die den Hoffnungsträger der US-Demokraten bei seiner Reise begleiten dürfen. Sie fliegen im selben Flugzeug, auf dem weithin sichtbar Obamas Kampagnen-Motto „Change we can believe in“ steht, sie fahren in derselben Kolonne, sie wohnen im selben Hotel, im Adlon am Pariser Platz, alle in der dritten Etage.
Und sie sind für Obama bedeutender als alle Zuschauer vor der Siegessäule zusammen: „Ich bin fast völlig von den Medien abhängig, wenn ich meine Wählerschaft erreichen will. Zumindest für die breite Öffentlichkeit bin ich, was die Medien sagen.“ Das hat ihm geholfen in den vergangenen Monaten, das ist aber auch eine ständige Bedrohung, gerade auf seiner ersten Tour in der „Welt jenseits unserer Grenzen“: „Denn was bedeutet das große Kontingent an Journalisten, das Obama folgt?“ fragt Dan Balz. „Es bedeutet, dass jeder Fehler oder jedes falsche Statement von ihm registriert und als Zeichen seiner Unerfahrenheit gewertet wird.“
Jedes Bild ist exakt geplant
Um all jene zu widerlegen, die ihm mangelnde außenpolitische Kenntnisse vorwerfen, hat Barack Obama diese Reise überhaupt angetreten. Jedes Ziel, jedes Bild ist darauf abgestimmt, welche Wirkung es in den Vereinigten Staaten entfalten könnte. Die Mitarbeiter von „Barack TV“, seinem eigenen Fernsehteam, sind angehalten, den Berlin-Debütanten möglichst auch so zu filmen, dass der US-Zuschauer das berühmte Brandenburger Tor im Hintergrund erkennen kann. Das ist nur eine Vorschrift von vielen. Das Rednerpult ist nicht auf die große Menge der Zuschauer ausgerichtet, sondern auf die TV-Kameras, in die Obama sprechen wird. Die ganze Szeneriewird perfekt ausgeleuchtet, fast so, als solle hier heute Abend ein Film gedreht werden. Über der Straße des 17. Juni fliegt ein Hubschrauber, der zeigen soll, wie viele Menschen gekommen sind, um Obama zu sehen. Es gibt wenige Lücken, die Inszenierung scheint perfekt.
Um solche Bilder und um starke Symbole für die Wähler daheim geht es. Und darum, was die bekannten US-Journalisten und TV-Kommentatoren über das sagen, was Obama sagt. CNN hat extra für die Rede die mehrfach ausgezeichnete Chefkorrespondentin Christiane Amanpour nach Berlin geschickt. Den ganzen Tag hat sie aus der Hauptstadt berichtet. Obama wolle nicht nur beweisen, dass er sich auf internationalem Parkett bewegen kann, sagt sie: „Den Amerikanern will er wohl zeigen, dass die Welt und Europa offen sind für bessere Beziehungen zu den Vereinigten Staaten, als es in den letzten Jahren unter George W. Bush der Fall war.“
Tanja Dückers findet, dass Barack Obama „schon jetzt mit seinem Auftreten den USA ein anderes Gesicht verliehen hat“. Die Schriftstellerin („Der längste Tag des Jahres“) ist mit acht Freunden – sie stammen aus Berlin, Kuba und den Niederlanden – zum Obama Viewing an die Siegessäule gekommen. „Ich finde, das ist ein historisches Ereignis. Mich interessiert, wie er auftritt, wie er sich von Bush abgrenzt“, sagt sie. Und dass sie kein Obama-Fan sei („mir fällt kein Politiker ein, von dem ich Fan bin“), ihn aber unbedingt erleben will.
Vor allem junge Leute kommen zu Obama
So geht es vielen: Es sind vor allem junge Leute da, Familien mit ihren Kindern, Menschen, die wahrscheinlich nicht einmal dann zum Auftritt eines deutschen Spitzenpolitikers gehen würden, wenn sie dafür drei Monate lang kostenlos tanken dürften. Zu Obama kommt sie, die angeblich für die Politik verlorengegangene Generation. „Bei Obama hat man das Gefühl, dass er einem näher steht als all die anderen Politiker, und dass er wirklich etwas bewegen kann“, sagt Elisa Minossi (23) aus Berlin. „Das ist vielleicht der zukünftige Präsident der USA, den muss ich mir anschauen“, sagt Anna Herz (16) aus Neustadt, die zusammen mit ihrer Mutter da ist. Florian Kirner (33) führt eine Gruppe von acht jungen Männern aus Bayern an, die für zehn Euro selbstgemachte Obama-T-Shirts verkaufen. „Das hier“, sagt er, „ist globaler Wahlkampf“, und darum gehe es ihm und den meisten – nicht darum, dass Barack Obama manchmal wie ein Popstar rüberkommt: „Ich bin ja kein Groupie, ich bin ein politisch interessierter Mensch.“
Das ist Volker Rühe auch. Der ehemalige Bundesverteidigungsminister steht nahezu unerkannt mitten im Obama-Volk. Einen VIP-Bereich gibt es nicht, und das findet Rühe auch in Ordnung so. Er ist extra wegen Obama aus Hamburg angereist, am Mittwoch schon: „Das ist heute eine einmalige Chance. Ich wollte die Reaktion der Leute erleben“, sagt er, und lobt den Demokraten: „Die eigentliche Leistung Barack Obamas ist, dass er die jungen Menschen, die College-Generation, wieder für Politik interessiert hat. Das schafft in Deutschland niemand.“
Schüler zur Begrüßung abkommandiert
Vielleicht haben sich Angela Merkel, Frank-Walter Steinmeier und Klaus Wowereit deshalb so gefreut, Obama persönlich kennenzulernen. Im Kanzleramt ist er zuerst: Um 10.57 Uhr fährt der Konvoi vor, und als Obama aus dem weißen Chrysler mit der Nummer O17–458 aussteigt, hat er auf einmal eine Schulklasse aus Dillingen vor sich. Die Elftklässler des St.-Bonaventura-Gymnasiums hatten eigentlich nur das Kanzleramt besuchen wollen. Weil sich die Besichtigung etwas verzögert hat und sie nicht mehr schnell genug rauskommen, werden sie flugs zum Empfangskomitee für den Gast umfunktioniert. Das passt zum Tag: Wo immer Obama auftaucht, seine jungen Anhänger sind schon da.
Bevor der Senator für eine gute Stunde zum Gespräch mit Angela Merkel verschwindet, geben die beiden ein Lehrstück in Sachen Politikerbegrüßung: Kaum hat sie ihn sanft an den Arm gefasst, greift er zurück und umgekehrt. Das sieht zeitweise etwas unbeholfen aus, aber zugleich auch herzlich. Und irgendwie wirkt die Kanzlerin aufgeregter als normalerweise bei Staatsbesuchen.
Aber das sind viele am gestrigen Obama-Tag. Hunderte Menschen und Dutzende Kamerateams erwarten den Senator vor dem Hotel Adlon, dessen Personal bis zuletzt so tut, als würde Obama hier gar nicht wohnen. Schließlich kommt er um 12.10 Uhr durch den Hintereingang, geht den langen Weg bis zur Lobby, ein schlanker Mann, der kleiner ist, als er im Fernsehen wirkt, und nicht so strahlend: „How are you?“ fragt er die zwei Dutzend amerikanischen Journalisten und Hotelgäste, die mehr zufällig vor den Fahrstühlen stehen.
Keine Angst vor Fotos
Er will gerade nach oben fahren, als er zwei bekannte Gesichter sieht. Man unterhält sich, Obama lässt sich filmen, und als ein Gast fragt, ob er ein Foto machen könne, sagt der Senator: „Ich habe keine Angst vor Fotos.“ Die Bodyguards mit den Sternen-Pins an den Revers zucken kurz. Dann ist er weg, wo genau er wohnt, sagt niemand. Ein gutes Dutzend Suiten hat sein Stab im Adlon reserviert, aber erst kurzfristig wird entschieden, in welche Obama zieht.
Die Präsidenten-Suite Brandenburger Tor (für 7600 Euro die Nacht) und die Präsidenten- Sicherheits-Suite (für 9600 Euro) sind nicht dabei, sie bleiben frei: Es wäre unklug gewesen, eine der beiden zu nehmen, weil es mit Sicherheit wieder böse Meldungen gegeben hätte, dass Obama sich schon wie der Präsident gebärde.
Das ist er nun einmal nicht, auch wenn die Auftritte in Berlin denen eines Präsidenten nicht nur ähneln, sondern etwa die letzten Besuche von George W. Bush bei weitem übertreffen. Dabei ist Barack Obama ja noch nicht einmal offizieller Kandidat der Demokraten und damit Frank-Walter Steinmeier näher, als es auf den ersten Blick scheint. Der mögliche SPD-Kanzlerkandidat bittet die Fotografen und Fernsehteams am Nachmittag gleich zweimal, vor und nach seinem Gespräch mit dem Gast, zu Aufnahmen ins Auswärtige Amt.
150 Journalisten drängen sich vor den beiden Politikern, es ist heiß und riecht nach Schweiß. Die Bilder, die hier entstehen, braucht der Deutsche mehr als der Amerikaner, den Kontakt sowieso: Vielleicht fährt Steinmeier nächstes Jahr zum Gegenbesuch mit vertauschten Rollen ins Weiße Haus, zum Präsidenten Obama. Niemand weiß es, und Fragen sind nicht erlaubt. Nur Angucken.
Zurück im Adlon empfängt Obama zum ersten Mal selbst einen einheimischen Politiker: Um 15.40 Uhr kommt Berlins Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit, der extra für den Amerikaner seinen Urlaub unterbrochen hat, ins Hotel, verschwindet in der Bibliothek im ersten Stock. Barack Obama erscheint zehn Minuten später. Die beiden Männer verstehen sich sofort, „ohne Anlaufschwierigkeiten“, wie Klaus Wowereit später sagen wird. Sie sprechen über das deutsch-amerikanische Verhältnis und natürlich über Berlin.
Training im Fitnessstudio
Dann treten der Regierende Bürgermeister und der designierte Kandidat ans Fenster der Bibliothek, um wenigstens von hier einen Blick auf das Brandenburger Tor zu werfen: „Ich glaube, er wäre gern mit mir da rausgegangen“, sagt Wowereit. Sicherheitsbedenken hätten leider dagegen gesprochen. Sie halten Obama allerdings nicht davon ab, gegen 16.40 Uhr das Hotel noch einmal durch den Hinterausgang zu verlassen. In Jogginghose und grauem T-Shirt fährt er zum Fitnesstraining ins Ritz-Carlton, spät am Abend geht es noch ins Borchardt.
Beides passt zu dem Eindruck, den die, die ihm nahe sein dürfen, von Obama haben. „Er ist sehr sympathisch, locker und cool“, sagt Stephan Interthal, der Geschäftsführende Direktor des Adlon. Er hatte sich Obamas Unterschrift für sein Gästebuch schon vor Wowereit abgeholt.
Der Regierende sagt über den Senator, dass er „sehr charmant und sehr informiert“ gewesen sei: „Er strahlt was aus, und das merken die Leute auch“, so Wowereit weiter. Und ja, er werde auch zur Siegessäule gehen, das sei selbstverständlich: „Es ist doch ein gutes Zeichen, dass Barack Obama die einzige Rede auf seiner Reise nicht in Paris oder London, sondern in Berlin hält. Das ist ein Kompliment an diese Stadt.“
Als kleines Dankeschön dafür hat ihm Wowereit einen Porzellanbären von KPM, zwei Knut-Figuren für die Töchter und ein Berlin-Buch geschenkt. Nur mit Obamas angeblichem Großcousin, Ekiri Obama, den plötzlich ein Team von „Spiegel TV“ Wowereit präsentiert, möchte der Regierende Bürgermeister nicht sprechen. Ekiri Obama stört es nicht, er freut sich darauf, seinen berühmten Verwandten am Abend reden zu hören, „auch wenn ich ihn persönlich noch nicht kennengelernt habe“. Mehr sagt er nicht, die Spiegel-TV-Leute ziehen ihn weiter, „sonst kriegen die anderen Fernsehteams die Geschichte noch mit“.
Erst kurz vor 18 Uhr kommt Barack Obama nach fast acht Stunden straffen Programms dazu, sich einen Augenblick in Ruhe auf das vorzubereiten, was er die „Freuden der Politik nennt“: Den Auftritt vor Zigtausenden Menschen, „die animalische Wärme beim Händeschütteln, das Bad in der Menge“. Dass es heute mehr als 100000 werden, ist schon gegen 17 Uhr klar. Wie auf Obamas Kampagnen-Logo ist die Sonne über Berlin herausgekommen, und die Menschen strömen die Straße des 17. Juni entlang, als würde das Finale der Fußball-Europameisterschaft wiederholt.
Hoffnung auf den Politikwechsel
Auch Katrin Sieg ist zwei Stunden vor dem angekündigten Beginn der Rede da. Die kleine Frau mit der roten Brille hätte Barack Obama längst einmal treffen können, lebt sie doch wie der Senator zeitweise in Washington, wo sie an der Georgetown University Kulturwissenschaften lehrt. Viele ihrer Studenten sind Wahlkampfhelfer, die seien unglaublich engagiert und gar nicht so wahl- und politikmüde, wie man es den jungen Amerikanern immer nachsagen würde. Professorin Sieg hofft nach „acht entsetzlichen Jahren Bush“ auf den Wechsel im Weißen Haus, auch wenn sie im Vorfeld „hin- und hergerissen war“ zwischen den finalen demokratischen Bewerbern: „Hillary Clinton konnte man einschätzen, aber Obama?“ Mehr als eine „messianische Figur“, ein Mann „mit unglaublichem Willen“ sei er eben noch nicht: „Und niemand weiß, wer im Hintergrund die Fäden zieht.“
Als sie sich knapp drei Stunden später auf den Rückweg in Richtung Brandenburger Tor macht, ist Katrin Sieg enttäuscht: „Er hat nichts zu kritischen, zu wichtigen Fragen der Politik gesagt, nur Nettigkeiten. Die große Begeisterung konnte da natürlich nicht aufkommen.“
Tanja Dückers findet Obama dagegen „besser, als ich es erwartet hatte. Es hat mir sehr gefallen, dass er sich so stark auf Berlin bezogen hat. Er hat das gut gemacht.“ Beides stimmt, sagt Marius Voigt. Er ist bei der Berliner Agentur FischerAppelt zuständig für politische Koordination, berät unter anderem deutsche Ministerien: „Barack Obama hat die Bilder bekommen, die er wollte. Er hat wahlkampfstrategisch alles richtig gemacht. Aber wirklich Neues hat er natürlich nicht erzählt.“
Ob er selbst zufrieden ist? Als Barack Obama um 20.40 Uhr ins Hotel kommt, sieht er erstmals an diesem Tag erschöpft aus. Das Lächeln ist weg, der Gang nicht ganz so leicht, nicht ganz so aufrecht wie sonst. Er gibt zwei italienischen Journalisten Autogramme, verschwindet dann für eine Stunde auf seinem Zimmer. Draußen, vor dem Adlon, reißt der Strom der 215.000 nicht ab. Im Vorbeigehen sagt eine junge Frau zu ihrem Begleiter: „Irgendwie hat der Obama heute geklungen wie ein ganz normaler Politiker.“ Genau das ist immer eine seiner größten Ängste gewesen.